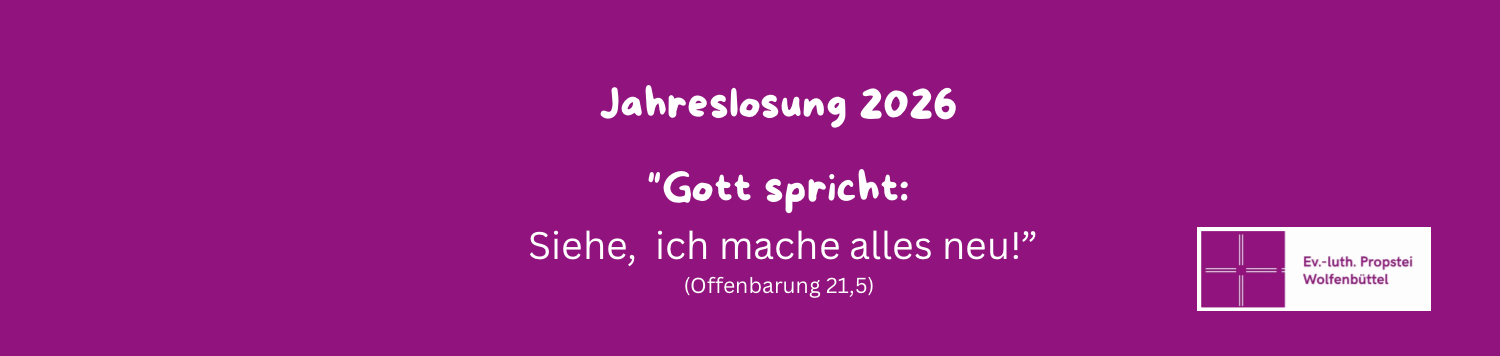Seit zwei Jahrtausenden begehen Christen die Passionszeit. Seit zwei Jahrtausenden folgen wir jedes Jahr vor Ostern der Leidensgeschichte Jesu. Viele beten den Kreuzweg, besuchen eine Passionsandacht oder den Gottesdienst am Karfreitag. Andere lesen den Text für sich aus einem der Evangelien. Noch andere hören eine Vertonung im Konzert oder aus der Konserve. Wir wandern Jahr für Jahr an allen den Abgründen entlang, die sich da auf tun: Wir stehen vor dem rätselhaften, unerklärlichen Verrat von Judas. Wir hören, wie Petrus voller Heldenmut den Mund zu voll nimmt, und wie dieser Mut ganz schnell schwindet. Wir sehen zu, wie die Verantwortlichen völlig verantwortungslos einer gefühlten Bedrohung nach geben und ihr ohne die kleinste Regung des Gewissens einen völlig Schuldlosen opfern. Wir werden von der aufgepeitschten Erregung der Masse durch geschüttelt.
Schließlich folgen wir auch den kleinen und doch so wichtige Spuren von Menschlichkeit. Joseph von Arimathia, der den Toten begräbt, und drei Frauen, die zur Totensalbung auf brechen (um dann die unfassbarste aller Überraschungen zu erleben), bewahren ein wenig Menschlichkeit, wenn es schon nicht in ihrer Macht steht, den Gekreuzigten zu retten. Sie wahren seine Würde als Mensch. Und das ist in dieser Situation unendlich wertvoll.
Zweitausend Jahre. Trotzdem gibt es immer noch etwas zu entdecken. Keine neuen Details, auch wenig neue geschichtliche Zusammenhänge. Die sind verhältnismäßig gut erforscht. Es geht eher um immer tiefere Einsichten in unsere eigene Natur. Es geht um Selbstwahrnehmung. Wir alle müssen lernen, wozu wir im Bösen und im Guten in der Lage sind, damit wir auf das achten, was wir tun und sagen.
Indem sie uns den Spiegel vor hält, lehrt die Passionsgeschichte uns Menschlichkeit. Dass ein Leser oder Hörer von ihr unberührt bleibt, nicht ins Nachdenken kommt, kann ich mir kaum vor stellen. Dazu müsste man sich schon völlig verschließen.
Die Einsicht in sich selbst muss wahrscheinlich jede Generation von neuem gewinnen und jeder einzelne Mensch für sich persönlich. Deswegen veraltet die Passionsgeschichte auch nach zwei Jahrtausenden nicht.
Martin Granse
Pfarrer im Pfarrverband Johannes der Täufer in Wolfenbüttel
Schließlich folgen wir auch den kleinen und doch so wichtige Spuren von Menschlichkeit. Joseph von Arimathia, der den Toten begräbt, und drei Frauen, die zur Totensalbung auf brechen (um dann die unfassbarste aller Überraschungen zu erleben), bewahren ein wenig Menschlichkeit, wenn es schon nicht in ihrer Macht steht, den Gekreuzigten zu retten. Sie wahren seine Würde als Mensch. Und das ist in dieser Situation unendlich wertvoll.
Zweitausend Jahre. Trotzdem gibt es immer noch etwas zu entdecken. Keine neuen Details, auch wenig neue geschichtliche Zusammenhänge. Die sind verhältnismäßig gut erforscht. Es geht eher um immer tiefere Einsichten in unsere eigene Natur. Es geht um Selbstwahrnehmung. Wir alle müssen lernen, wozu wir im Bösen und im Guten in der Lage sind, damit wir auf das achten, was wir tun und sagen.
Indem sie uns den Spiegel vor hält, lehrt die Passionsgeschichte uns Menschlichkeit. Dass ein Leser oder Hörer von ihr unberührt bleibt, nicht ins Nachdenken kommt, kann ich mir kaum vor stellen. Dazu müsste man sich schon völlig verschließen.
Die Einsicht in sich selbst muss wahrscheinlich jede Generation von neuem gewinnen und jeder einzelne Mensch für sich persönlich. Deswegen veraltet die Passionsgeschichte auch nach zwei Jahrtausenden nicht.
Martin Granse
Pfarrer im Pfarrverband Johannes der Täufer in Wolfenbüttel